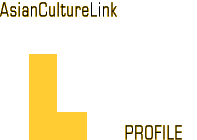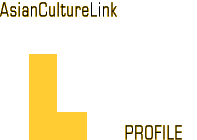Die Lange Nacht der Chinesischen Musik eröffnet Berlins "MaerzMusik"
Was, wenn Musik nichts anderes wäre als der brüchige Rand um die
Stille herum? Vielleicht ist sie ja das, was die Stille umgibt, um ihr eine
Fassung zu geben wie der Rahmen einem Gemälde? Jene neue chinesische
Musik, die zur Eröffnung des neuen Berliner Festspiele-Festivals "MaerzMusik"
zu hören war, erweckt jedenfalls den Eindruck, als klinge die Stille
in China anders als bei uns.
Zwei Konzerte gab es an diesem Abend, eines vom Nieuw Ensemble Amsterdam,
das die Neutöner aus China auf modernen Instrumenten zu Gehör bringt
und eines vom ebenso vorzüglichen China Found Music Workshop aus Taipei,
das neue Kompositionen mit traditionellen Instrumenten aufführt, mit
Mundorgel und Pipa (der chinesischen Laute), Röhrengeige und Zither.
In den schönsten Momenten versetzten beide das Publikum in Trance. Diese
Musik behelligt einen nicht. Sie lässt das Blut langsamer zirkulieren
und putzt einem die Ohren.
Der Bambusflötenspielen hält eine Lackschale in der Hand, wirft
Silberkugeln hinein und bringt sie zum Kreiseln, bis das Klacken der Kugeln
sich in einen hohen, sirrenden Klang verwandelt. Der Bariton Shi Kelong artikuliert
Vokale mit der Autorität eines verführerischen Despoten, die Sopranistin
Ellen Schuring betört den Hörer mit schmeichlerischen Glissandi.
Hypnotisch vibrierende Klangflächen wechseln mit auskomponierten Seufzern,
Klavier und Pipa horchen einander neugierig aus: Wo sind wir ähnlich,
was unterscheidet uns? Es ist eine Musik der minimalen Differenz, deren Expression
ins Innere zielt. Nicht die großartig ausholende melodische Geste sorgt
für den Ausdruck, sondern die Konzentration auf die Aura eines fragilen
Geräuschs, der Pause, des einzelnen Tons. Er blüht auf und vergeht,
wird zerdehnt, zerfasert und vom Schlagwerk mit Wucht zusammen gepresst.
Trauergesänge, Klanggespinste. Das schmerzerstarrte Klagelied in Qu Xiaosongs
"Mist", nach den Versen der im 18. Jahrhundert verschleppten Dichterin
Cai Wenji. Die amorphen Tonfiguren in Shih Pei-Yus "Chieh I", die
sich unmerklich zu eindringlichen Rhythmen organisieren. Der Humor in Bernhard
Gáls "Of Sound and Time", der Störgeräusche vom
Huster bis zum Handy-Klingeln in seine zyklische Zeit-Studie einbaut. Und
die Einsamkeit im simultan-chaotischen "Wörterbuch der Winde",
Sandeep Bhagatis Auftragswerk für beide Ensembles zusammen: All das kommt
uns in seiner Fremdheit hautnah - und hätte doch der ein oder anderen
Erklärung bedurft.
Die Berliner Festspiele wollen mit der "MaerzMusik" neue Hörer
gewinnen, jenseits des Fachpublikums. Es kann nicht schaden, ihnen mit ein
paar Worten entgegen zu kommen. Wer mehr weiß, der hört auch mehr.
Christiane Peitz, Der Tagesspiegel, 10.3.2002