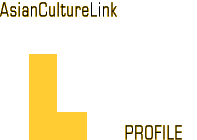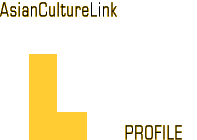Die "Lange Nacht der chinesischen Musik"
Das Nadelöhr, durch das seit den späten achtziger Jahren die Musik
einer neuen Generation chinesischer Komponisten auch Europa erreichte, liegt
in den Niederlanden. Dort, wo man in mancher Hinsicht musikalisch neugieriger,
unbefangener reagiert, war es vor allem das Nieuw Ensemble Amsterdam, das
intensive Kontakte zu jener Musikszene knüpfte, die sich nach dem Ende
der Kulturrevolution neu entwickelte. Kompositionsaufträge wurden vergeben,
Stücke entstanden, die die exotischen Reizwerte der chinesischen Musik
- ihr Zeitgefühl und den expressiven Klang - mehr oder minder seriös
in adaptierten westlichen Idiomen einem europäischen Publikum zu vermitteln
suchten.
Eine Auswahl aus diesem Repertoire stellte das Nieuw Ensemble jetzt bei der
MaerzMusik vor. Zur "Langen Nacht" der Chinesischen Musik wurde
das Konzert durch den sich anschließenden Auftritt des China Found Music
Workshop aus Taipeh. Dieser spielte, umrahmt von zwei traditionellen, klanglich
aIlerdings ziemlich aufpoliert wirkenden Stücken, eine Reihe neuer Stücke,
in denen sich taiwanesische und europäische Komponisten mit dem traditionellen
chinesischen Instrumentarium auseinandersetzen.
Auch in Japan und Korea gibt es Tendenzen, die sich auf ähnliche Weise
um eine Verschmelzung europäischer und asiatischer Musik aus der eigenen
Perspektive heraus bemühen; was dort entsteht, könnte auch für
uns vielleicht einmal zur großen Bereicherung werden, jenseits aller
modischen Stilisierungen. Momentan allerdings erscheint ziemlich unklar, wie
fruchtbar diese neue Auseinandersetzung vom Künstlerischen her jenseits
der Bedienung eines neuen Marktes möglicherweise einmal sein wird.
Gleich drei Kompositionen des zweiten Konzertes entstanden als Auftragswerke
der Berliner Festspiele. Das Ergebnis nach sechs langen Stunden wirkte ziemlich
ernüchternd. Man vermißte vor allem Stücke, die über
die frohe Botschaft der kuIturellen Begegnung hinaus aus sich selbst heraus
sprechen und zum Nachdenken, neuen Hören und Empfinden bewegen können.
Vielleicht war es auch symptomatisch, daß, je repräsentativer die
Stücke ihr Thema abhandelten, desto mehr die Klischees dominierten.
Unter den drei Uraufführungen wirkte Sandeep Bhagwatis im stets berechenbaren
Wechsel von europäischer und chinesischer Klanggruppe sich unendlich
hinziehendes Stück am wenigsten profiliert: im fleißigen Handwerk
zusammengestrickt, auch wenn kitschige eigene Textz tiefsten Gehalt signaIisieren
sollten. Ein kurzes, atemlos vorwärtstreibendes Tanzstück von Shi
Pei-Yu entwickelte in den zwischen Klang und Geräusch dahinhuschenden
Gesten immerhin starke Atmosphäre.
Weit mehr passierte jedoch in "Die Gesichter des Buddha" von Tung
Chao-Ming. Das Opus gewinnt seine suggestive Sprache aus einer grundsätzlichen
Erforschung des Instrumentariums heraus, nie wirkt der Klang hier schon fertig
vorgegeben, neben dem schönen Ton herrschen merkwürdig gebrochene,
beschädigte Klänge, die sich voll assoziativer Energie fortspinnen
- spirituell, aber auch mit Zügen von urbaner Ironie. Wunderbar konnte
man hier erleben, mit welch unglaublicher Konzentration die acht taiwanesischen
Musiker, darunter eine Schlagzeugerin von geradezu akrobatischer Körperbeherrschung,
auch ohne Dirigenten wie auf einem einzigen gemeinsamen Atem zusammenspielten.
Das erste Konzert brachte zunächst eine verkitschte Cage-Adaption von
Tan Dun, in der das Publikum wie eine Gospelgerneinde ein bißchen mitzuseufzen
hatte. Ferner Stücke, die sämtlich, vielleicht gerade weil sie vonwiegend
europäische Instrumente benutzten, nicht recht aus den Hörklischees
chinesischer Musik herausführten: den langsam ansetzenden und sich bescheunigenden
Pulsen, silbrigen Tremoloklängen und überwältigenden crescendo-Walzen.
Einzige Ausnahme bildete "Mist" (englisch) von Qu Xiao-Song. Hier
verschwinden beim Hören all solche repräsentativ-leeren Kategorien
wie "chinesisch" oder "europäisch", obwohl diese
Musik von ihrem Zeitgefühl und von der Versenkung in den Einzelklang
her sicherlich ganz chinesisch geerdet ist. Zwischen zwei Sing-Stimmen und
den Instrumenten entwickelt sich aus minimalistischen Klangzeichen - einem
drohenden tiefen Brummton, einem Seufzer des Soprans -, die von den Instrumenten
aufgefangen und entwickelt werden, im Handumdrehen ein komplexes Drama. Psychologisierendes
Erzählen und montageartige Abstraktion wechseln sich auf faszinierende
Weise ab, Einfühlung und Distanzierung nähern und entrücken
das Fremde, das hier als ein Teil des Menschlichen überhaupt erscheint.
Sei dies chinesisch oder deutsch.
Martin Wilkening, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.03.2002