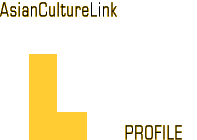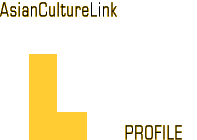Das neue Berliner Festival MaerzMusik entdeckt die chinesische Avantgarde,
das "mikroskopische Musiktheater", Cage und Stockhausen.
von Volker Hagedorn
Die Nalepastraße liegt auf dem Falkplan im Quadrat X7, und so sieht
es da auch aus, am Ostrand von Berlin, wo Kraftwerksschlote qualmen und tote
Gleise im rissigen Asphalt versinken. Eine Tarkowskysche Zone, in der ein
gewaltiger Baukomplex steht, längst abgewickelt, halb vergessen - die
Produktionsstätten der DDR-Rundfunkanstalten. Drinnen riecht es noch
nach Sozialismus, nach zu heißen Heizungen und ranzigen Plastepolstersesseln,
außerdem nach frischem Kaffee und neuen Kabeln. Für einen Tag und
eine Nacht wurde der Laden noch mal aufgemacht. Für John Cage, der vor
acht Jahren starb und nun eine der Hauptfiguren im neuesten deutschen Musiktreffen
ist, der MaerzMusik. Dieses Festival für aktuelle Musik ist quer über
die Hauptstadt verteilt. Zum Ostrand pendeln gecharterte Busse bis drei Uhr
nachts, und sie sind nicht leer.
Es kommen Digitalfreaks und Bildungsbürger, Donaueschingenveteranen und
Großstadtabenteurer. Man entdeckt Cage und die DDR auf einmal, sitzt
im getäfelten Saal 3 und sieht sich 4'33'' an. Zu hören gibt es
ja nichts in diesem Klassiker von 1952: Vier Minuten und dreiunddreißig
Sekunden lang erzeugt ein Musiker keinen Klang. Der Applaus am Ende ist nicht
ironisch. Die Leute mögen Cage. Der heitere freie Geist aus Amerika passt
auf leicht wahnsinnige Art ideal in diese sozialistische Radiotitanic. Zumal
es ja insgesamt 43 Darbietungen sind, die allein für die zwölf Stunden
Si-mul-ta-ne-ous Si-lence verknüpft wurden: Frühes von Cage sowie
Stücke und Installationen lebender Kollegen jeglicher Generation, die
darauf direkt oder im weitesten Sinne Bezug nehmen, wobei verschwiemelte Neo-Fluxus-Peinlichkeiten
ebenso ihren Platz haben wie minimalistische Treppenhausbeschallungen oder
sieben Uraufführungen nach Cages 1958er Bastelbogen Fontana Mix. Da dirigiert
Dieter Schnebel, weißhaariger Katechist des offenen Kunstwerks, mit
milder Miene eine kammermusikalische Hommage mit schreitenden Sängern,
anschließend werden zum selben Zweck von Matthew Rogalsky drei Powerbooks
vernetzt - die obligatorischen Kultwerkzeuge der um 1970 geborenen Computermusiker.
Und vorher gibt es natürlich die Tonbänder zu hören, die der
Zufallsmeister Cage selbst aufnahm.
Fernöstliches Pianissimo
Ist es ein Zufall, dass sein eigener Mix, Langwellengurgeln, Alltagslaute,
fahles Rauschen, Überlagerungen und Stille von vor 40 Jahren auf acht
Kanälen, am gegenwärtigsten, schwerelosesten, klarsten wirkte? Bei
ihm, der absichtsvolles Musikmachen mit ritueller Sorgfalt vermied, erzeugen
die Klänge gleich welcher Stücke immer wieder eine ganz bestimmte
Art von Gedankenweite und Helligkeit, als hätten sie selbst insgeheim
eine Absicht entwickelt.
Und man kommt dabei, ganz wie John Cage es beabsichtigte, zur Ruhe. Die ist
auch nötig inmitten eines Festivals, das an elf Tagen mit vierzig Veranstaltungen
auf sieben "Themeninseln" Dimensionen erreicht, die ans Kulturprogramm
einer Weltausstellung erinnern. So etwas kann man nicht aus dem Hut zaubern.
MaerzMusik ist die jährliche Nachfolgerin der keineswegs erfolglosen
Biennale für zeitgenössische Musik und bekommt vom Bund 650 000
Euro.
Sie will die Veränderungen der Musikszene spiegeln, das Aufbrechen des
eurozentrischen Avantgardebegriffs. Die Biennale hatte sich aufs Komponieren
im Osten und Westen Deutschlands konzentriert, jetzt wird man global. "Wir
wollen polyzentrisch, nicht hierarchisch denken", meint Matthias Osterwold,
der künstlerische Leiter, "gegen die natürliche Tendenz, Scheuklappen
auszubilden." Das reicht von der "biosensorischen Vernetzung"
bis zum klassischen Rihm-Konzert, von China bis Lou Reed.
Der wird am Sonntag höchstpersönlich Klangregie führen, wenn
sein berüchtigtes Album Metal Machine Music, eine Rückkopplungsorgie
der siebziger Jahre, erstmals als konzertantes Instrumentalwerk zu hören
ist. Ein anderer Pionier elektrisch generierter Klänge saß schon
am vergangenen Wochenende im Parkett des Festspielhauses und überprüfte,
ob alles seine Ordnung hatte. Denn Karlheinz Stockhausen nimmt, anders als
John Cage, seine Interpreten in strenge Zucht.
Zwar rühmte sich das Produktionsteam, der Opernakt "Michaels Jugend"
aus dem Donnerstag der Licht- Heptalogie werde erstmals "unabhängig
vom Komponisten" inszeniert, aber der hat in seiner Partitur nun mal
viele szenische Details fixiert. Für die steife Krippenspielästhetik,
die Stockhausen seinen Regisseuren bislang aufnötigte, fürchtet
man ihn fast ebenso wie für seine Interviews.
Immerhin gelingt es Cornelia Heger und ihrem Ausstatter Fred Pommerehn, wenigstens
die Hälfte der autobiografisch-kosmischen Heldenlegende szenisch zu entschlacken.
Wie Teile einer Installation bewegen sich Michael und seine Eltern auf quadratischer
Fläche zwischen komprimierten Objekten aus Hausrat und Militaria, die
an Interieurs von Ed Kienholz erinnern. Zugleich singen Hubert Mayer, Ksenija
Lukic und Jonathan de la Paz Zaens mit einer Präzision, die aus dem Text
selbst Material werden lässt. Der gefühlsferne Duktus der Linien
verrät auch etwas vom Trauma des Weltkrieges, das der Komponist hier
bannen will. Die aufgeräumte Geometrie der Bühne hilft beim Hören
der komplexen Struktur aus Gesang, Instrumentalsoli und Bandzuspielungen.
Sie wirkt zwingend, und die sperrige Rhythmik setzt sich über den Gesang
der Mutter bis zur Ornamentik der Tänzerin einmal so spannend auf allen
Ebenen fort, dass so etwas wie eine Ekstase der Abstraktion entsteht. Aber
leider gibt es auch eine Handlung. Der präsumptive Weltenretter Michael
muss, während seine Eltern sterben, einem Sternenmädchen folgen
wie weiland Siegfried dem Waldvögelein - und die tapsige Balz eines Tenors
in Siebziger-Jahre-Hosen mit Schlag um eine flügelschlagende Bassetthornistin
kommt den klammen Ritualen früherer Licht -Versuche peinigend nahe. Michaels
anschließende "Prüfung" wird endgültig auch eine
fürs Publikum, so zäh und symbolschwer geht sie vonstatten.
Wer dabei einzunicken droht, hat sich nichts vorzuwerfen, aber wer sich entspannen
will, fährt besser neun U-Bahn-Stationen weiter zum Hebbel-Theater. Dort
wird man von einer Platzanweiserin mit priesterlich gesenktem Ton gebeten,
die Schuhe abzulegen, und tappt dann im Dämmerlicht zwischen Kiesinseln
ins Innere eines großen stilisierten Ohrs. Ringsum stehen Percussionisten
und rühren die zarten Klänge zurecht, die Klaus Lang für kirschblüten.ohr
geschrieben hat.
Das Ohr hat Claudia Doderer erdacht, die im "mikroskopischen Musiktheater"
trennen will, was die Oper gewaltsam verband, nämlich Licht und Ton.
Nur wenn die Felle und Metalle der leisen Schlagzeuge schweigen, glimmen ein
paar Lampen auf, und man kann nachsehen, ob die andern Gäste schon in
Trance gefallen sind oder konzentriert über die ausgetüftelten Schwingungsmuster
nachdenken. "Ick hatt ja nich den Bolero erwartet", meint hinterher
eine ältere Besucherin, "aber'n bisschen mehr könnte schon
sein ..."
Traditionell ist hier nur noch der Applaus. Der muss sein, den wird es immer
geben, er hat schon die Auflösung der Diatonik, den Serialismus und die
Aleatorik überstanden, und mit seiner Hilfe erkennen die Türsteherinnen
auch in der Universität der Künste bei der Langen Nacht der chinesischen
Musik, ob ein Stück vorbei ist. Die chinesische Avantgarde mag Klänge
im Pianobereich, die durch keine Tür dringen. Es sei denn, ein Komponist
wie Tan Dun verlangt vom Publikum, dass es auf einen Wink des Dirigenten hin
in kollektives Geschrei ausbricht. Das funktionierte zum Festivalauftakt eindrucksvoll
und war noch nicht mal peinlich. Tan Duns Circle ist so offen (wenn auch keineswegs
beliebig) angelegt, dass selbst ein verirrtes Handyklingeln darin seinen Platz
findet.
Die Nacht der Chinesischen Musik bot übrigens auch ein Stück, in
dem ein Handy vorgesehen ist, und zwar in Kombination mit traditionellen chinesischen
Instrumenten. Das fiel aber weit verkrampfter aus als die Musik, die das Nieuw
Ensemble unter Ed Spanjaard auf klassisch europäischen Klangerzeugern
spielte. Diesen Musikern sind viele neue Stücke von chinesischen Komponisten
zu verdanken. In Amsterdam sammelten sich Komponisten, die erst nach Maos
Kulturrevolution die westliche Avantgarde entdecken konnten. Diesen Schock
verarbeiteten sie auf eine Weise, die oft farbiger und origineller wirkt als
die Musik der Vorbilder. Bei Mo Wuping und Chen Qigang fällt außerdem
das wunderbare Timing auf. So, wie die Instrumente atmen und aus den Zerrklängen
der gealterten Westavantgarde leuchtende Farben gewinnen, so atmen auch die
Strukturen. Und zur Kunst, im richtigen Augenblick Schluss zu machen, lässt
sich viel von den Chinesen lernen.
In der Knappheit der Formulierung bleiben die Berliner Taxifahrer allerdings
unübertroffen. Als einer von ihnen erfuhr, sein Fahrgast habe an zwei
Tagen elf Stunden lang neuer Musik gelauscht, fragte er bloß: "Soll
ick Sie dann nicht lieber gleich ins Krankenhaus bringen?"
"MaerzMusik" bis zum 17. März, Infos unter
030/25 48 90 und www.maerzmusik.de
Die Zeit, Feuilleton 15.03.2002